Zwangsarbeit als Beginn des Holocaust – Neues Buch von Frank Grelka
Der Historiker Dr. Frank Grelka beschreibt in seinem am 24. September 2025 erschienenen Buch „Mörderische Verschwendung“ die Zwangsarbeit in den von Deutschland besetzten polnischen Gebieten als Beginn des Holocaust. Er rückt die Erinnerungen überlebender Zwangsarbeiter*innen in den Fokus, die unter entmenschlichenden Umständen im Distrikt Lublin Entwässerungsgräben anlegen mussten. Mit seiner Arbeit zeigt Grelka auf, wie die Zwangsarbeit fern von wirtschaftlicher Effizienz die Vernichtung polnischer Jüdinnen und Juden zum Ziel hatte.
Wie begann der Holocaust? Dieser Frage geht Frank Grelka vom Viadrina Center of Polish and Ukrainian Studies (VCPU) in seinem im Harrassowitz Verlag erschienenen Band nach. „Mit meiner Studie möchte ich die Frühphase der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik neu beleuchten – aus der Nähe der Quellen, aus der Perspektive der Betroffenen und mit Blick auf die Mechanismen deutscher Besatzungspolitik, die aus ,Verschwendung‘ ein Instrument des Holocaust machte“, so Grelka.
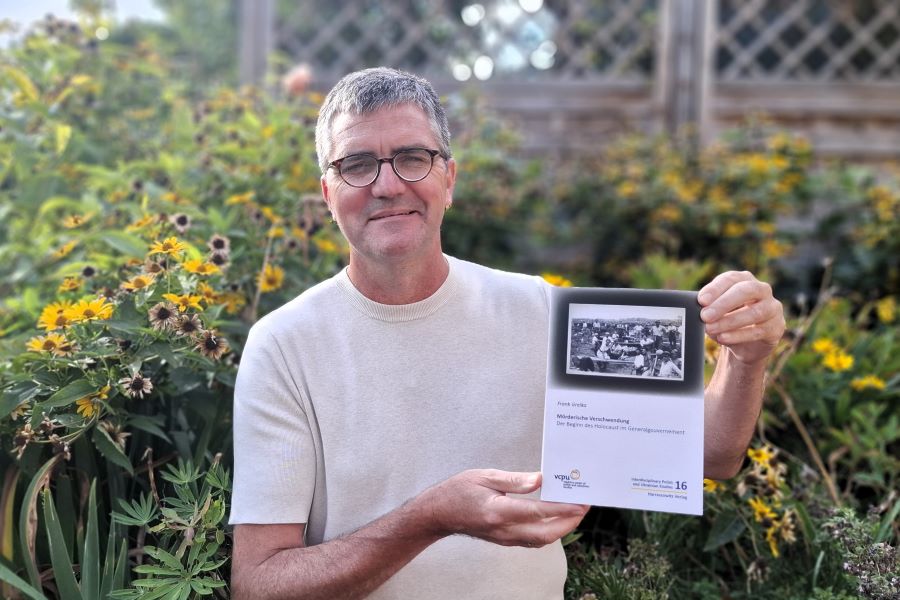
Privat
Für seine Monographie stützt er sich auf drei bislang kaum gemeinsam ausgewertete Quellengruppen: die Akten der drei größten sogenannten Judenräte in Częstochowa, Warschau und Lublin, die Verwaltungs- und Haushaltsunterlagen der Finanzabteilung der deutschen Regierung im Generalgouvernement sowie Berichte von Arbeiter*innen und jüdischen Hilfsorganisationen, die versuchten, das Leid in den Wasserwirtschaftslagern zu lindern. „Besonders wichtig war mir die Perspektive der wenigen Überlebenden – ihre Handlungsspielräume und ihr Überlebenswillen –, um der Erfahrung der großen Mehrheit der jüdischen Zwangsarbeiter gerecht zu werden, die nicht überlebten“, begründet Frank Grelka, warum er sich welchen Quellen gewidmet hat.
Im Zentrum seiner Untersuchung stehen 16 Lager für jüdische Zwangsarbeiter*innen (ZAL), in denen seit dem Sommer 1940 die Ärmsten der polnischen Jüdinnen und Juden – oft barfuß, ohne Lohn und notdürftig untergebracht – gezwungen wurden, Entwässerungsgräben zur Trockenlegung von Sumpfgebieten im Osten des Distrikts Lublin zu schaufeln. Die Bedeutung dieser Wasserwirtschaftslager für die Frühphase der Verfolgung im deutsch besetzten Polen sei bislang kaum erforscht worden, so Grelka. In seinem Buch beschreibt er eine „verschwenderische Ökonomie“. Er belegt, dass die Zwangsarbeit dazu diente, die Zahl der polnischen Jüdinnen und Juden bereits vor der Einrichtung der Gaskammern maximal zu reduzieren. Zudem kamen die durch Erpressung gewonnenen Vermögen nicht der deutschen Kriegswirtschaft zugute, sondern wurden im Haushalt des Generalgouvernements angehäuft.
Mit seiner Ausarbeitung bietet Frank Grelka drei Antworten auf die Frage, wie der Holocaust begann: Zum einen sieht er die Arbeits- und Finanzpolitik als Auftakt. „Ich gehe davon aus, dass die Arbeits- und Finanzpolitik der Regierung des Generalgouvernements keiner ökonomischen Rationalität folgte, sondern den Beginn des Holocaust in Polen markierte.“ Zudem wird durch die Quellen klar: Arbeit war kein Rettungsweg. Die Judenräte hätten früh die mörderische Verschwendung von Menschenleben in wirtschaftlich sinnlosen Arbeitsprogrammen erkannt, so Grelka. Schließlich weist der Historiker personelle und strukturelle Kontinuitäten von den frühen Zwangsarbeitslagern zu den Vernichtungslagern nach: Seit dem Frühjahr 1942 wurden die Wasserwirtschaftslager zu Transitlagern und damit zum Vorhof des Vernichtungslagers Sobibór.
Erschienen ist das Buch als Band 16 in der Reihe „Interdisciplinary Polish and Ukrainian Studies“. Redakteur des Bandes ist Dr. Gero Lietz vom VCPU. Das Projekt wurde finanziert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Dank der Förderung durch den Publikationsfonds des Landes Brandenburg steht die Monographie allen Interessierten im Open-Access-Format zur Verfügung.
Frauke Adesiyan
Zurück zum Newsportal
Beitrag teilen: