„Ich hatte das Gefühl, Deutschland hat mir die jüdische Unbeschwertheit genommen“ – Lesung mit Tanya Raab
Die Autorin und Influencerin Tanya Raab hat am 8. Mai 2025 ihr Buch „Shalom zusammen!“ an der Viadrina vorgestellt. Dabei wechselte sie nahtlos von unterhaltsamen Anekdoten über ihr Leben als junge, queere Jüdin zu aufklärerischen Appellen und nachdenklichen Äußerungen über die Erinnerungskultur an den Nationalsozialismus in Deutschland. Die Buchvorstellung war eine Veranstaltung der Abteilung für Chancengleichheit, der Hochschulseelsorge und dem Oekumenischen Europa-Centrum Frankfurt (Oder) e. V.
„Wollt ihr was zum Lachen oder Holocaust?“ Mit solchen Fragen, begleitet von einem Grinsen, setzt Tanya Raab den Ton für die Lesung im Senatssaal. Offensichtlich will und kann sie beides mühelos: unterhaltsame Anekdoten aus ihrem Leben als junge, queere Jüdin zwischen Lehramtsstudium, Influencerin-Dasein und Dating-Portalen einerseits und Aufklärung und Mahnung andererseits – freundlich und doch ohne Scheu, ihr Gegenüber auch vor den Kopf zu stoßen.
Lesung Tanya Raab
Die Lesung findet am 8. Mai statt, 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Auch in Brandenburg wird dieses Datum an vielen Orten als Tag der Befreiung begangen – eine Formulierung, die Tanya Raab kritisiert. „Wovon wurden die Deutschen denn befreit? Von einer Partei, die sie gewählt haben? Viele Deutsche haben bis zu den letzten Kriegstagen gegen ihre Befreier gekämpft, sie wollten nicht befreit werden. Das vergessen wir hier manchmal“, betont die Autorin, die in der Ukraine geboren ist und in Frankfurt (Oder) aufwuchs. Sie wünsche sich eine ehrlichere, vielseitigere Erinnerungskultur, auch was die Überlebenden des Holocaust angeht. Ihre Vorfahren hätten die Massenerschießungen an der Ostfront überlebt. „Die Täter waren keine KZ-Wärter, das waren einfache Soldaten oder Polizisten, von denen die wenigsten nach der NS-Zeit bestraft wurden“, sagt sie.
Immer wieder schweift sie in der Veranstaltung von ihrem Buch ab, wechselt zwischen gelesenen Passagen und Erzählungen, ohne dass die Grenzen immer klar sind. Die Gäste im gut gefüllten Saal hören ihr gespannt zu. Auch die Familie von Tanya Raab ist gekommen. „Ich bin ja hier in meiner alten Hood“, sagt sie gleich zu Beginn und erzählt, wie sie vor der Lesung bei ihrer Großmutter Borschtsch gegessen hat. 2000 im ukrainischen Krementschuk geboren, kam Tanya Raab mit ihren Eltern drei Jahre später nach Frankfurt (Oder) und wuchs hier auf. Das Jüdische sei in ihrer Familie eine kulturelle Angelegenheit, religiös erzogen wurde sie nicht, auch wenn die postsowjetisch geprägte jüdische Gemeinde eine wichtige Rolle im Alltag spielte. Die Auseinandersetzung mit dem Jüdisch-Sein begleitete Tanya Raab durch ihre Jugend. Wenn in der Schule der Holocaust behandelt wurde, konnte sie sich nicht mit den als namenlose, passive Opfer dargestellten Jüdinnen und Juden identifizieren. Zum Wendepunkt wurde eine Reise mit ihrem Großvater nach Israel, wo sie ein ganz anderes jüdisches Leben kennenlernte. „Ich kam richtig wütend zurück, weil ich das Gefühl hatte, Deutschland hat mir die jüdische Unbeschwertheit genommen.“ Sie beschloss nicht ohne jugendlichen Trotz: „Ich werde sichtbar und offen als Jüdin leben.“
Sichtbar bedeutete damals ein Davidstern an der Halskette, später eine Kippah auf dem Kopf. Inzwischen hat sich ihre Sichtbarkeit auf Instagram vertausendfacht. Ob als Influencerin oder Autorin: Bei allem Witz ist die Mission von Tanya Raab unüberhörbar. „Ich erkläre Kindern was der Schabbat ist, und Rentner*innen, dass der Antisemitismus nicht nur von Ausländern kommt“, erzählt sie von ihrem Alltag. Auch die Lesung an der Viadrina nutzt sie für klare Botschaften. „Jüdische Menschen sind niemandem ihre Familiengeschichte schuldig“, sagt sie nachdrücklich. Außerdem fordert sie das Publikum im Rahmen einer „kleinen Alltagshilfe“ auf: „Bitte sagt ,Jude‘, sagt ,Jüdin‘. Das ist keine Beleidigung!“ Wenn mal wieder verdruckst von „Menschen jüdischer Herkunft“ die Rede ist, sei das zwar mitunter unterhaltsam. „Es zeigt aber auch, dass wir mit dem Wort Jude Negatives verbinden, weil wir alle antisemitisch sozialisiert sind“, so die Autorin.
Als datende, queere Frau erlebt Tanya Raab eine Exotisierung und Fetischisierung von Jüdinnen und Juden – auch davon erzählt das Buch. Menschen, die sie über Online-Plattformen kennenlernt, erzählen ihr kontextlos über ihren Besuch in der KZ-Gedenkstätte Auschwitz oder betonen, dass sie schon immer mal Sex mit einer Jüdin haben wollten. Diese Anekdoten verdeutlichen, dass irgendwie nichts normal und alltäglich ist im Umgang mit Jüdinnen und Juden, 80 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus in Deutschland. Deutlich wird das auf traurigere Art auch, wenn Tanya Raab davon erzählt, dass sie ihre vierjährige Tochter lieber nicht mit Kippah in die Kita in Brandenburg an der Havel gehen lässt. „Ich will ihr keine Angst einjagen und nehme ich ihr damit nicht auch ihre jüdische Identität?“, fragt sie sich als Mutter.
Es ist also nicht nur witzig, über das Jüdin-Sein in Deutschland zu erzählen und aufzuklären. Und trotzdem kann es unterhaltsam, bunt, vielschichtig und hintersinnig sein. Entsprechend reagiert das Publikum mit einigen neugierigen Fragen, viel Applaus und der ein oder anderen gekauften Ausgabe von „Shalom zusammen!“.
Frauke Adesiyan
Zurück zum Newsportal




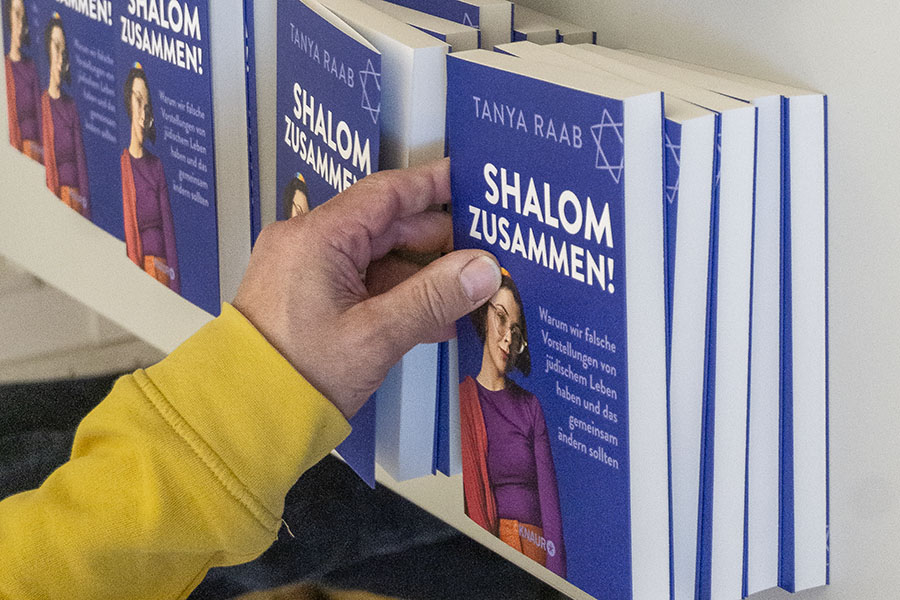
Beitrag teilen: