Gespräch über Desinformation im Wahlkampf
Wie gelingt seriöse Wahlberichterstattung? In welchem rechtlichen Rahmen findet sie statt? Und wie können Medien mit Herausforderungen wie Desinformation und Propaganda umgehen? Um diese und andere Fragen ging es bei den 21. Frankfurter Medienrechtstagen zum Thema „Medien und Wahlen“, die am 12. und 13. Februar 2025 in Kooperation mit der Konrad-Adenauer-Stiftung an der Europa-Universität Viadrina stattfanden. Um die herausfordernde Berichterstattung im aktuellen Bundestagswahlkampf ging es bei einem Podiumsgespräch am ersten Konferenztag.
„Ich hätte im Vorfeld dieser Bundestagswahl noch mehr Desinformation erwartet“, sagt der Rechtsanwalt Dr. Frederik Ferreau in seinem Vortrag zu Beginn der Veranstaltung „Desinformation im Bundestagswahlkampf und Gegenmaßnahmen“. Im weiteren Verlauf der Veranstaltung diskutiert er mit dem Initiator und Organisator der Medienrechtstage, Prof. Dr. Johannes Weberling, sowie den Journalistinnen Beate Bias und Susann Michalk, stellvertretende Chefredakteurin und stellvertretende Digitalchefin der Märkischen Oderzeitung (MOZ). Die Veranstaltung ist eine von vielen Gesprächsrunden während der 21. Medienrechtstage in Frankfurt. In Vorträgen und Podiumsdiskussionen haben Medienschaffende und Forschende kurz vor der Bundestagswahl an der Viadrina ein Blick auf Erfahrungen der letzten US-Präsidentschaftswahlen geworfen, Wahlen und Propaganda in Südosteuropa besprochen und über die Rolle der Landesmedienanstalten und Medienregulatoren debattiert.
21. Medienrechtstage
In seinem Vortrag gibt Ferreau einen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf Desinformation und erläutert aktuelle Beispiele aus dem Wahlkampf. „Desinformation ist im Deutschen kein Rechtsbegriff“, erklärt Ferreau, wobei das nicht bedeute, dass das deutsche Recht nicht auf das Phänomen reagiere. Aber es sei eben keine feststehende Rechtsnorm und damit auch nicht zwangsläufig strafbar. Das Bundesverfassungsgericht, erklärt Ferreau, habe aber festgehalten, dass die Verbreitung von unwahren Tatsachenbehauptungen nicht von der Meinungsfreiheit geschützt sei.
Was das konkret bedeuten kann, erklärt Ferreau an aktuellen Praxisbeispielen. Da geht es zum Beispiel um sogenannte Deep-Fake-Videos, in denen Karl Lauterbach oder Friedrich Merz zu sehen sind. Urteile gibt es dazu noch nicht. Zu einem etwas älteren Video, in dem Olaf Scholz zu sehen ist, hingegen schon. Das Zentrum für Politische Schönheit hatte Ende 2023 ein Deep-Fake-Video verbreitet, in dem Olaf Scholz scheinbar verkündete, die Bundesregierung wolle die AfD verbieten. Die SPD hatte daraufhin beim Landesgericht Berlin einen Antrag gestellt, die Verbreitung des Videos zu unterbinden und damit auch Recht bekommen. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass das Video so täuschend echt sei, dass es für unbedarfte Zuschauer nicht ersichtlich sei, dass es sich nicht um ein echtes Video handele. Es bestehe die Gefahr der Zuordnungsverwirrung, hieß es damals vom Landgericht Berlin.
Wie komplex insbesondere die politische Berichterstattung geworden ist, davon erzählen auch Beate Bias und Susann Michalk von der MOZ. Dabei hätten sie momentan weniger mit Desinformation zu kämpfen als mit versuchter Einflussnahme auf die Berichterstattung an sich. Hackerangriffe auf die Portale von MOZ und Lausitzer Rundschau hätte es bereits gegeben. Dadurch hätten sie viele User und das Vertrauen mancher Leserinnen und Leser verloren. Bias berichtet aber auch von vermehrten Anfeindungen. Der Ton würde immer rauer, vor allem vor Wahlen; manchmal würden Journalistinnen und Journalisten beschimpft oder auf Demonstrationen auch physisch bedroht. Manche Menschen erreiche sie gar nicht mehr, sagt Bias: „Argumente ziehen einfach nicht mehr.“ Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass es nicht nur Aufgabe von Medien sei, gesellschaftlichen Dialog zu fördern, sondern auch die der Zivilgesellschaft.
„Das wichtigste Kriterium für seriöse Medien ist, transparent zu sein“, stellt Susann Michalk fest. Wenn Fehler passieren, dann sei ein aufrichtiger Umgang damit wichtig; die müsse man geraderücken und offen damit umgehen. Weberling betont, dass diese Seriosität von Medien im Recht durchaus belohnt werde. Der Umgang mit gezielter Desinformation scheint da komplizierter. Michalk erzählt, dass das auch oft mit einem Paradox zu tun habe. Einerseits möchte man Desinformation enttarnen, entkräften und vor allem aufklären. Andererseits bedeute das aber immer auch die Reproduktion der ursprünglichen Desinformation.
Lea Schüler
Zurück zum Newsportal


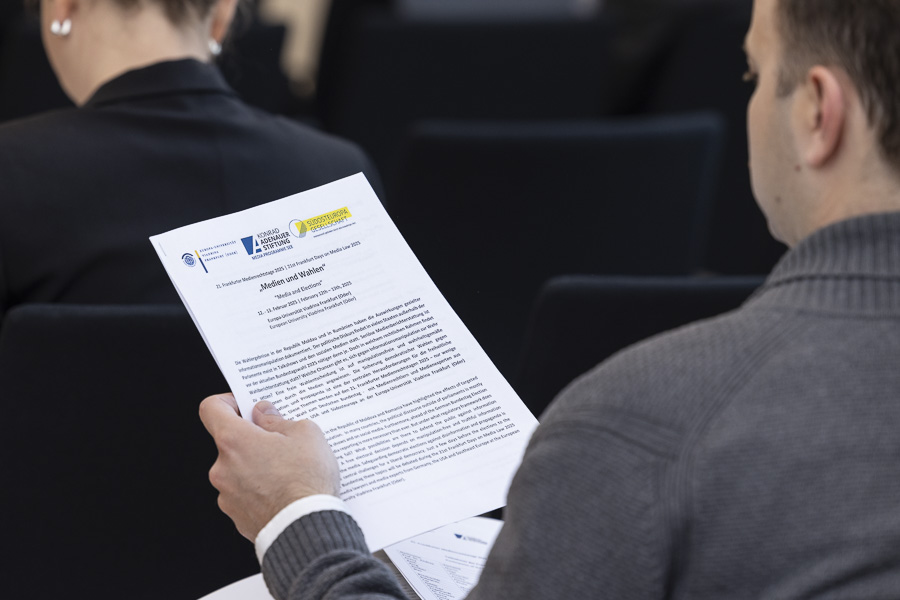




Beitrag teilen: